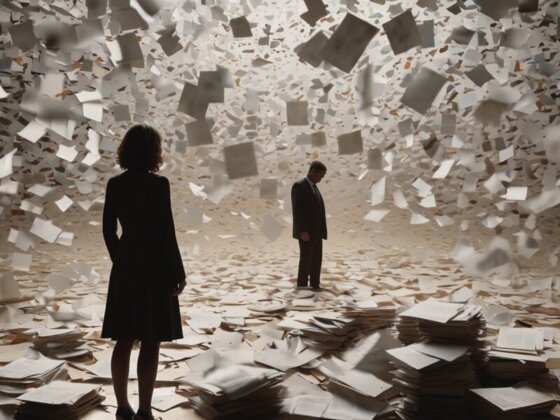- Die US-Regierung plant, eine Eigenkapitalbeteiligung an Intel im Austausch für bereits zugesagte Fördermittel zu erhalten. US-Handelsminister Howard Lutnick betont das Interesse an einer zehnprozentigen Beteiligung, um die heimische Produktion zu unterstützen. Analysten äußern Bedenken über mögliche Interessenkonflikte und Parallelen zu europäischem Misserfolg in ähnlichen Industriebeteiligungen. Die Komplexität der Verhandlungen wird durch nationalen Sicherheitsinteressen und wirtschaftliche Erwägungen beeinflusst. Kritiker argumentieren, dass zeitlich begrenzte Vereinbarungen sinnvoller sind als vollständige Verstaatlichungen.
Die US-Regierung verfolgt das Ziel, im Austausch für Fördermittel, die das Unternehmen bereits zugesagt bekommen hatte, eine Eigenkapitalbeteiligung an Intel zu erlangen. Diese Taktik ist Bestandteil der Bestrebungen der Regierung, die Chipproduktion in den USA zu fördern. US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte, dass man für das gewährte Geld eine Beteiligung zurückerhalten wolle. Der Gedanke, den Gesprächen zufolge eine zehnprozentige Beteiligung an Intel zu erlangen, könnte dem angesehenen Chip-Hersteller helfen, seine in den USA ansässigen Produktionsanlagen zu finanzieren. Diese sind in der Konstruktion und Wartung kostspielig, während die Nachfrage nach Intel-Chips in jüngster Zeit rückläufig ist.
Hintergründe der Industriepolitik
Einige Branchenexperten und Mitglieder der Trump-Administration betonen, dass der Erhalt von Intel entscheidend für die nationale Sicherheit der USA sei. Dadurch könnte die Abhängigkeit von ausländischen Chipproduzenten verringert werden. Andererseits äußern Analysten und Ökonomen Bedenken hinsichtlich eines möglichen Interessenkonflikts. Stephen Moore, ein langjähriger Wirtschaftsberater von Trump, kritisiert diese Pläne als Rückkehr zur Verstaatlichung. Europa habe häufig ähnliche Modelle versucht – mit wenig Erfolg.
Die US-Regierung hat in der Vergangenheit mehrfach in private Unternehmen investiert. In den 1980er-Jahren floss Geld in die Synthetic Fuels Corporation, eine milliardenschwere Investition in Unternehmen, die flüssige Brennstoffe aus Kohle, Ölschiefer und Teersanden produzierten. Später, nach der Finanzkrise 2008, sicherten staatliche Gelder den Fortbestand von Automobilherstellern und Banken.
Ökonomische Erwägungen
Aktuell hat das Verteidigungsministerium vereinbart, ein Unternehmen für Seltene Erden in den USA zu unterstützen, um die Abhängigkeit von China zu minimieren. Doch Moore führt an, dass solche Vereinbarungen idealerweise zeitlich begrenzt sein sollten. Eine vollständige Verstaatlichung wird selten als optimal betrachtet. Neuere Beispiele zeigen dabei eine stärkere Verflechtung von Staat und Privatwirtschaft auf.
Das Beispiel Intel offenbart, wie komplex solche Verhandlungen sein können. Die Verlobung der Trump-Administration bei Nippon Steel unterstreicht die Bedeutung von nationalen Sicherheitsinteressen in wirtschaftlichen Entscheidungen. Intel selbst zeigt sich in seinen Aussagen loyal gegenüber der Regierung unter Trump, mit einem starken Fokus auf technologischer und industrieller Führerschaft.
Nicht zuletzt beschreiben Analysten wie Patrick Moorhead die US-Investitionen als kurzfristig vorteilhaft für Intel: Gerade in einer Zeit, in der staatliche Förderungen an spezifische Meilensteine gebunden sind, könnte solch eine Beteiligung den Fluss von Kapital sicherstellen. Fragen bleiben jedoch, ob diese Maßnahmen die gewünschten Effekte im Bereich der inländischen Chipproduktion tatsächlich erzielen können.