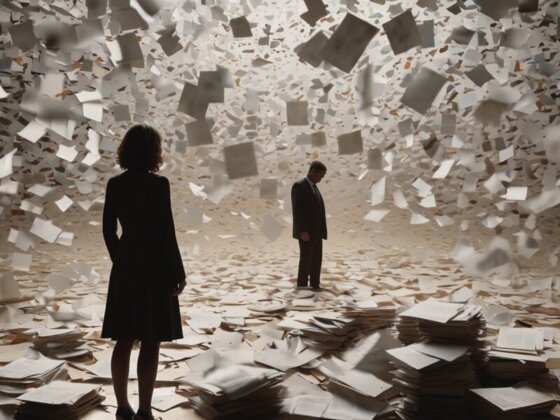- Eine umfassende Analyse zeigt, dass Maßnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit Jugendlicher durch Social-Media-Nutzung erforderlich sind. Einschränkungen und Altersbeschränkungen für Plattformen wie Instagram und TikTok werden von Experten gefordert, um psychische Erkrankungen vorzubeugen. Die Verwendung von Smartphones in Bildungseinrichtungen sollte bis zur zehnten Klasse untersagt werden, um Ablenkungen zu minimieren. Experten betonen die Notwendigkeit elterlicher Kontrollen und einer verbesserten Medienkompetenz für Lehrende. Der Digital Services Act der EU wird als Grundlage für stärkere Regulierungen gegen digitale Abhängigkeit gesehen.
Eine umfassende Analyse der Nutzung von Smartphones und sozialen Medien durch Jugendliche legt nahe, dass dringend Maßnahmen zum Schutz junger Nutzer erforderlich sind. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina argumentiert, dass die Einschränkungen von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok notwendig seien. Diese Plattformen sollten erst ab 13 Jahren zugänglich sein, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Untersuchungen deuten darauf hin, dass der übermäßige Konsum dieser Medien mit einem besorgniserregenden Anstieg psychischer Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen korreliert. Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie, hebt hervor, dass vor allem der Druck durch soziale Vergleiche zur Entwicklung von Essstörungen führen kann. Zudem sei ein immer früherer Beginn der Social-Media-Nutzung festzustellen, wobei sogar Sechsjährige bereits aktiv sind.
Psychische Gesundheit und digitale Welt
Die Expertengruppe warnt, dass eine intensive Nutzung von sozialen Medien essenzielle soziale Fähigkeiten hemmt. Kinder und Jugendliche, die viel Zeit online verbringen, versäumen es, wichtige Strategien zur Emotionsbewältigung und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Studien zeigen, dass eine Reduzierung der Mediennutzung zu einer Verbesserung der emotionalen Gesundheit führen kann, insbesondere wenn die Zeit für sportliche Aktivitäten genutzt wird. Diese Verbesserung ist ein Indikator dafür, dass die bisherigen Mediengewohnheiten schädlich sind und eine Neuausrichtung dringend notwendig ist.
Altersbeschränkungen und neue Regularien
Um diese Gefahren zu reduzieren, schlägt die Expertengruppe vor, Zugangsbeschränkungen und elterliche Kontrollen einzuführen. Ab dem geplanten Eintrittsalter von 13 Jahren sollten Plattformen von Jugendlichen nur mit Zustimmung der Eltern genutzt werden können. Zudem sollen Funktionen, die Sucht fördern, eingeschränkt werden. Dazu gehören das Abschalten von Push-Benachrichtigungen und das Limitieren von Scrollfunktionen. Weiterführend fordert man, dass personalisierte Werbung für Minderjährige unterbleibt und nur altersgerechte Inhalte gezeigt werden. Auch die Einführung digitaler Altersnachweise auf EU-Ebene, wie das „EUDI-Wallet“, wird unterstützt, um eine konsequente Altersüberprüfung zu gewährleisten.
Smartphones und Bildungseinrichtungen
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Nutzung von Smartphones in Bildungseinrichtungen. Die Expertengruppe schlägt vor, diese bis zur zehnten Klasse zu verbieten, um klare Trennlinien zwischen Bildung und ständiger digitaler Präsenz zu ziehen. Kinder sollten die Möglichkeit haben, Räume zu erleben, die frei von der ständigen Verlockung der Social-Media-Welt sind. Zusätzlich sollen Medienkompetenzmaßnahmen für Lehrende eingeführt werden, um das Bewusstsein für potenziell problematisches Nutzungsverhalten zu stärken.
Einfluss sozialer Medien auf die Jugend
Johannes Buchmann, einer der emeritierten Professoren und Mitautoren des Diskussionspapiers, hebt den Einfluss von sozialen Medien auf die Aufmerksamkeit junger Menschen hervor. Da der präfrontale Kortex bei Jugendlichen noch nicht vollständig ausgereift ist, fällt es ihnen schwer, sich von den ständigen Ablenkungen loszureißen. Dies führt oft dazu, dass andere Aktivitäten, wie soziale Interaktionen in der realen Welt, vernachlässigt werden. Der Ruf nach politischen Maßnahmen ist laut, um der zunehmenden digitalen Abhängigkeit entgegenzutreten. Der Digital Services Act der EU bietet eine Grundlage, braucht jedoch stärkere Regulierungen, um eine effektive Umsetzung zu gewährleisten.