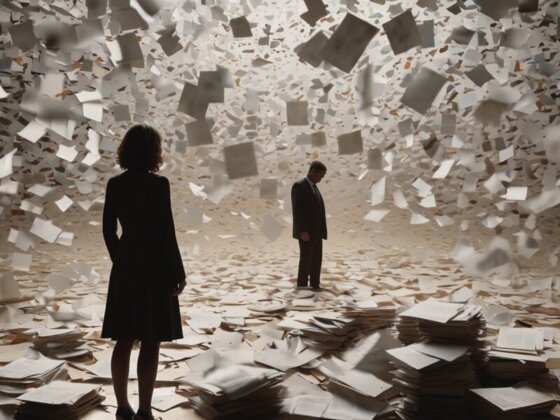- Trump plant Zölle auf ausländische Filme, was die Filmindustrie in Aufruhr versetzt. Die Unsicherheit über die Umsetzung der Zölle wirft viele Fragen zur Produktion von Filmen auf. Zölle könnten zu vermindertem Filmdreh führen oder Kinopreise erhöhen. Ein Steuerkreditprogramm wäre eine effektivere Alternative, aber Trump zeigt kein Interesse daran. Die Komplexität und mögliche negative Effekte der Zölle bedrohen die US-Filmindustrie und könnten die Marktposition schwächen.
In einer Branche, die sich auf die Produktion von Filmen und TV-Sendungen spezialisiert hat – im Handelsjargon als Dienstleistungen und nicht als Produkte bezeichnet – mag Hollywood gedacht haben, es sei sicher vor den Einflüssen von Präsident Donald Trump. Doch am letzten Sonntag änderte sich diese Annahme drastisch. Trump äußerte sich auf Truth Social und verkündete, die US-Filmindustrie sei „im Sterben begriffen“ und er plane, sie mit seinem bevorzugten Hebel wiederzubeleben: Zölle. Geplant war ein 100-prozentiger Zoll auf Filme, die in „ausländischen Ländern produziert“ wurden. Bis Montag bremste zwar der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, diese Aussage ab und erklärte, es seien keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden. Doch die Filmindustrie geriet dennoch in Aufruhr.
Erneuerung der Filmindustrie?
Die Aktien von Streaming-Diensten wie Netflix und Medienkonzernen wie Disney fielen, obwohl die eigentliche Unsicherheit in einer viel komplexeren Frage lag: Wie sollten solche Zölle überhaupt funktionieren? Zölle, wie Trump sie einsetzt, sollen Importe so unattraktiv machen, dass Unternehmen ihre Produkte im Inland fertigen. Filme jedoch sind keine Produkte, die über Schiffe zu heimischen Häfen gelangen und dort besteuert werden können. Würden die Zölle auch für ausländische Filme gelten, die von US-Vertrieben erworben werden? Was wäre mit US-Studios, die einige Szenen im Ausland drehen? Und was ist mit Fernsehserien?
Unvorhersehbare Effekte und Alternativen
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Zölle den gewünschten Effekt erzielen, wäre ein föderales Steuerkreditprogramm für Filmemacher – etwas, wofür sich kalifornische Politiker jahrelang eingesetzt haben – eine viel stärkere Alternative. Trump hat dafür bisher jedoch kein Interesse signalisiert. Die Verwirrung über Trumps vorgeschlagene Zölle rührt von den komplizierten Produktionsstrukturen moderner Filme her. Hollywood-Studios drehen seit Jahren aus steuerlichen Gründen im Ausland, sei es im Vereinigten Königreich, Kanada oder Australien. Dortige Anreize subventionieren die Kosten für lokale Produktionsanlagen und Mitarbeiter. Auch Aspekte wie visuelle Effekte und Postproduktion werden oft ausgelagert. Würde ein solcher Zoll tatsächlich Arbeit in die USA zurückbringen? Eventuell würden Studios einfach weniger Filme drehen oder – wie Verbraucher es bei Zöllen auf andere Produkte gesehen haben – die Preise für Kinobesuche würden steigen.
Der Einfluss auf den lokalen Markt
Kinoanalyst David Hancock schrieb kürzlich, es sei „ziemlich schwer zu erkennen, was die US-Regierung tatsächlich verzollen könnte“. Filme sind oft digitale Dateien und die Rechte an ihnen werden häufig zwischen verschiedenen Beteiligten aufgeteilt. Eine Möglichkeit wäre, US-Produzenten das Arbeiten im Ausland zu verbieten, was die Anzahl der produzierten Filme deutlich reduzieren und die Filmindustrie schwächen würde. Alternativ müsste ein umfassendes Steuerkreditsystem geschaffen werden, um den Studios zu helfen, ihre Produktion aufrechtzuerhalten, ohne dass die Kosten explodieren. Der Vorstoß zur Einführung von Zöllen scheint teilweise von Schauspieler Jon Voight initiiert worden zu sein. Er, Sylvester Stallone und Mel Gibson wurden von Trump als Hollywood-„Botschafter“ gewählt, um ihn zu beraten.
Die Herausforderung besteht darin, wie disruptiv oder finanziell schädlich die Zölle für die Studios sein könnten. Auch die mögliche Implementierung eines nationalen Steuerkredits steht zur Debatte. Trotzdem gibt es vonseiten der Filmindustrie Bedenken, dass diese Maßnahmen die US-Marktposition weiter erschüttern und die Kosten letztlich auf die Konsumenten umgelegt werden.