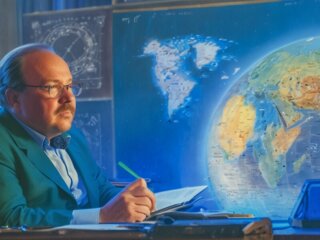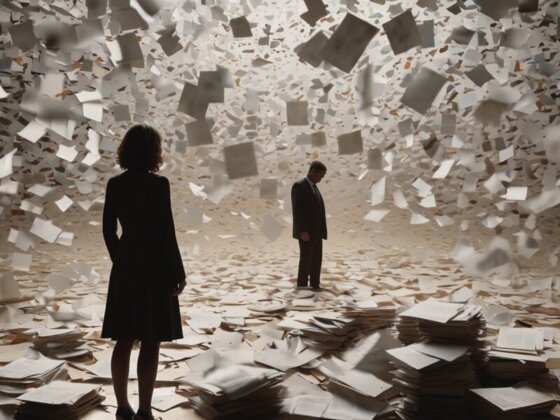- Der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 markierte den Beginn des Atomzeitalters. Hiroshima und Nagasaki bleiben trotz nur zweimaligem Einsatz der Atombombe Mahnmale der Kriegsführung und weltweiten Bedrohung. Trotz Abrüstungsbemühungen existieren weltweit noch über 12.000 Atomwaffen. Wissenschaftler wie Leo Szilard und Enrico Fermi trugen maßgeblich zur Entwicklung der Kernspaltung bei. Die Entwicklung der Kernspaltung führte schließlich zur Entstehung thermonuklearer Bomben wie der Zar-Bombe.
Am 6. August 1945 wurde der Himmel über der japanischen Stadt Hiroshima von einem blendenden Lichtblitz erhellt, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerschlag. Eine ganze Stadt pulverisiert in Sekundenschnelle. Damit begann das Atomzeitalter. Heute, 80 Jahre nach der Explosion der ersten Atombombe, bleibt Hiroshima ein mahnendes Symbol in unserem kollektiven Gedächtnis und unserer Furcht vor einer erneuten Katastrophe. Obwohl Atombomben nur zweimal eingesetzt wurden – in Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki – bleibt ihre Existenz eine bedeutende Bedrohung. Trotz zahlreicher Abrüstungsbemühungen und internationaler Verträge existieren heute immer noch mehr als 12.000 Atomwaffen weltweit.
Von der Idee zum Atom
1933, Adolf Hitler wurde Kanzler von Deutschland und etablierte das totalitäre Nazi-Regime. In diesem Jahr hatte der ungarische Wissenschaftler jüdischer Herkunft, Leo Szilard, der vor den Nazis nach Großbritannien geflohen war, eine revolutionäre Idee. Wenn man ein Atom mit einem Neutron beschoss und dieses sich daraufhin spaltete und weitere Neutronen freisetzte, könnte eine Kettenreaktion erzeugt werden. Diese Reaktion würde eine enorme Energiemenge freisetzen und das Potenzial für die Entwicklung einer Waffe war offenkundig. Der italienische Physiker Enrico Fermi, der ebenfalls vor dem Faschismus nach New York geflüchtet war, entdeckte 1938, dass Uran diese Kettenreaktion ermöglichen könnte. Aus Angst, die Nazis könnten diese Entdeckung ebenfalls machen, wurde 1940 ein geheimes Programm ins Leben gerufen, das von Arthur Compton geleitet wurde. Compton bildete ein Forschungsteam, dem auch Fermi und Szilard angehörten, um Experimente zu nuklearen Kettenreaktionen durchzuführen.
Der Weg zur Kernspaltung
Am 2. Dezember 1942 fand unter dem Footballfeld der Universität von Chicago das erste wirkliche Experiment mit einem Reaktor statt, der den ersten von Menschenhand geschaffenen stabilen nuklearen Reaktionsprozess erreichte und Szilards Idee bestätigte. 1943 übernahm Julius Robert Oppenheimer die Leitung des Projekts in den Los Alamos-Laboren in New Mexico, wo das erste echte nukleare Gerät entwickelt und gebaut wurde. Am 16. Juli 1945 zündeten die USA dieses Gerät in der Wüste von New Mexico. Zwanzig Tage später, am 6. August, traf eine ähnliche Bombe die japanische Stadt Hiroshima. Am 9. August folgte Nagasaki, was kurz darauf zur Kapitulation Japans und dem Ende des Zweiten Weltkriegs führte.
Eine Materie der Kerne
Atome bestehen aus einem Kern aus Neutronen und Protonen, um den Elektronen kreisen. Diese Kerne können sich zu größeren Atomen verbinden oder in kleinere Atome zerfallen. Im ersten Fall spricht man von Kernfusion, einem Prozess, der in Sternen stattfindet. Wissenschaftler versuchen, diesen Prozess als Energiequelle im Labor nachzuahmen. Beim Zerfall eines Kerns spricht man von Kernspaltung. In Kernkraftwerken wird dieser Prozess kontrolliert genutzt, während er in Atombomben absichtlich unkontrolliert erfolgt. Schwere, instabile Atome zerfallen in leichtere, wobei Energie freigesetzt wird. Überschüssige Neutronen triggern weitere Spaltungen. Material muss hohe Kritikalität erreichen, um Kettenreaktion zu initiieren. In einem Reaktor ist dies Ziel, bei einer Bombe wird es überschritten.
Von Spaltung zu Fusion
Bislang besprochene Waffen sind klassische Atombomben, basierend auf Spaltung. Ausgelöst durch eine chemische Explosion wird eine Masse aus Uran oder Plutonium komprimiert. Weiterentwicklungen führten jedoch zur Fusion: Thermonukleare Bomben basieren auf einer Sequenz von zwei Explosionen. Die primäre Explosion durch Spaltung löst eine sekundäre Explosion aus, die die Fusion von Wasserstoffatomen triggert. Die mächtigste dieser Art, die Zar-Bombe, wurde 1961 in der Arktis getestet.