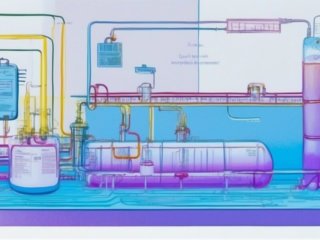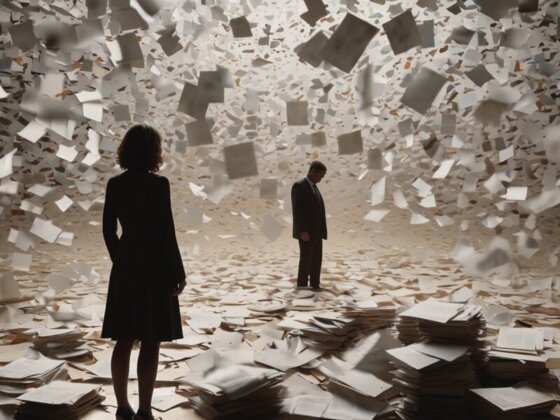- Die Bundesnetzagentur hat das Hochlaufentgelt für das Wasserstoff-Kernnetz auf 25 € pro kWh/h/a festgelegt. Diese Entscheidung bietet Marktteilnehmern Klarheit und Zugang zu vertretbaren Konditionen. Das Entgelt ist bis 2055 konstant, wird jedoch alle drei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der Entgeltbeschluss basiert auf dem Mechanismus des Wasserstoff-Aufbaus und der Kostenallokation bis 2055. Anfangs ist das Entgelt nicht kostendeckend, um hohe Infrastrukturausgaben und Marktschwächen auszugleichen.
Die Bundesnetzagentur hat heute das sogenannte Hochlaufentgelt für das Wasserstoff-Kernnetz auf 25 € pro kWh/h/a festgesetzt. Diese Entscheidung bringt Klarheit für Marktteilnehmer und schafft Zugangsmöglichkeiten zum Wasserstoff-Kernnetz zu vertretbaren Konditionen. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hebt hervor, dass Planungssicherheit nun gegeben sei.
Bestimmung und Berechnung des Hochlaufentgelts
Das Hochlaufentgelt ist flächendeckend und einheitlich ausgestaltet. Es wird von Nutzern des Kernnetzes für die Ein- und Ausspeisung von Wasserstoff entrichtet. Zentral ist die Balance zwischen Kostendeckung bis zum Jahr 2055 und wirtschaftlicher Attraktivität. Die Höhe von 25 € pro kWh/h/a basiert auf einer präzisen Untersuchung diverser Szenarien zum künftigen Wasserstoffmarkt. Die Entwicklungsprognosen der Bundesnetzagentur, unterstützt durch Expertenwissen, beziehen sich sowohl auf den Bau der benötigten Infrastruktur als auch auf marktliche und politische Einflussfaktoren.
Überprüfung und Anpassung der Entgelthöhe
Obwohl das Entgelt an die jährlich allgemeine Geldwertentwicklung angepasst wird, bleibt es bis 2055 prinzipiell konstant. Dennoch wird es alle drei Jahre überprüft, um auf Änderungen zu reagieren. Wesentlich ist, ob es weiterhin ausreichend Erlöse generiert, um das Kostenallokationskonto bis 2055 auszugleichen und marktgerecht bleibt. Bei Bedarf wird das Entgelt angepasst.
Hintergrund des Hochlaufentgelts
Diese Festlegung baut auf dem Beschluss WANDA vom Juni 2024 auf, der den intertemporalen Kostenallokationsmechanismus für das Wasserstoff-Kernnetz definierte. Ziel ist es, anfängliche Nachfrageschwächen und hohe Kosten der Infrastruktur auszugleichen, um von Beginn an unerschwingliche Entgelte zu verhindern. Anfangs liegt das Hochlaufentgelt unter den kostendeckenden Sätzen, was zu Mindererlösen führt. Später sollen diese durch mehrjährige Mehrerlöse kompensiert werden, die zu einem Plus führen. Die Anfangsverluste werden buchhalterisch erfasst, um sie künftig auszugleichen.